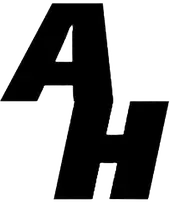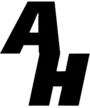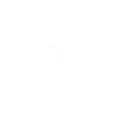Ursache und Risikofaktoren - Wenn das Zuhause im Chaos versinkt
Für die meisten Menschen ist ihr Zuhause ein Ort der Geborgenheit. Doch was passiert, wenn sich Besitztümer stapeln, Wege kaum noch begehbar sind und der Alltag hinter einem Berg von Dingen verschwindet? Das sogenannte Messie-Syndrom, fachlich als Hoarding Disorder bezeichnet, betrifft Millionen Menschen weltweit – oft im Verborgenen.
Betroffene haben große Schwierigkeiten, sich von Gegenständen zu trennen, auch wenn diese längst keinen Gebrauchswert mehr haben. Die Folge sind vollgestellte Wohnungen, soziale Isolation und erhebliche Einschränkungen der Lebensqualität. Doch hinter dem Chaos steckt weit mehr als bloße Unordnung: Das Messie-Syndrom ist eine komplexe psychische Störung, deren Ursachen tief in der Biografie, der Genetik und dem sozialen Umfeld verwurzelt sind¹.
In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf die Entstehung dieser Erkrankung – und zeigen, warum ein verständnisvoller, differenzierter Blick auf Betroffene so wichtig ist.
Ursachen und Risikofaktoren des Messie-Syndroms
Das Messie-Syndrom – medizinisch als Hoarding Disorder bezeichnet – ist heute als eigenständige psychische Erkrankung anerkannt¹. Betroffene haben große Schwierigkeiten, sich von Besitztümern zu trennen, selbst wenn diese keinen funktionalen Wert mehr haben¹. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von psychologischen über genetische bis hin zu sozialen Faktoren. Häufig wirken mehrere dieser Einflüsse zusammen und verstärken sich gegenseitig.
Psychologische Faktoren: Trauma, Bindung und Persönlichkeit
Viele Menschen, die später an einer Hortungsstörung leiden, haben in ihrer Kindheit und Jugend belastende Erfahrungen gemacht². Studien zeigen, dass über die Hälfte der Betroffenen ihre Symptome nach einem traumatischen Ereignis wie einem Verlust, einer Trennung oder Vernachlässigung entwickelten².
Unsichere oder instabile Bindungserfahrungen gelten ebenfalls als bedeutender Risikofaktor³. Wer in jungen Jahren wenig emotionale Sicherheit erlebt hat, neigt dazu, emotionale Lücken später durch eine starke Bindung an Gegenstände zu kompensieren³.
Diese Objekte werden zu „Ersatzsicherheiten“, an denen festgehalten wird, um die Angst vor Verlust oder Einsamkeit zu lindern³.
Ein weiteres häufiges Merkmal ist ein stark ausgeprägter Perfektionismus¹. Viele Betroffene stellen extrem hohe Ansprüche an ihre Entscheidungen („Was ist, wenn ich es doch noch brauche?“) und vermeiden es daher, sich von Dingen zu trennen¹.
Entscheidungsunfähigkeit und Aufschiebeverhalten sind eng damit verknüpft¹. Oftmals fürchten Messies, eine falsche Wahl zu treffen, wenn sie etwas entsorgen – also wird lieber gar keine Entscheidung gefällt, was zum Anwachsen der Unordnung führt¹.
Genetische und neurobiologische Aspekte
Zwillingsstudien belegen, dass das Messie-Syndrom auch eine genetische Komponente aufweist⁴. Die Erblichkeit der Hortungsneigung wird auf etwa 30–50 % geschätzt⁴.
Eine große genetische Analyse von 2022 fand sogar Überschneidungen zwischen den genetischen Risikofaktoren für pathologisches Horten und jenen für Schizophrenie und Autismus-Spektrum-Störungen, nicht aber für Zwangsstörungen oder Depressionen⁴.
Auch die Gehirnstruktur und -funktion unterscheiden sich bei Menschen mit Hoarding Disorder. Bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) zeigen, dass insbesondere der vordere cinguläre Cortex und die Insula bei Entscheidungen über persönliche Besitztümer stark aktiviert sind⁵.
Diese überschießende Aktivität führt dazu, dass das Wegwerfen eigener Gegenstände als bedrohlich oder extrem unangenehm erlebt wird⁵.
Gleichzeitig zeigen Messies in neutralen Entscheidungssituationen eine geringere Aktivität in genau diesen Hirnarealen, was auf Defizite in der Emotionsregulation und Entscheidungsfindung hinweist⁵.
Dazu kommen häufig kognitive Besonderheiten wie eine schwächere Kategorisierungsfähigkeit, ein geringeres Arbeitsgedächtnis und mangelnde Flexibilität im Denken⁵.
Viele Betroffene vertrauen ihrem Gedächtnis nicht ausreichend und heben deshalb Dinge auf, um im Zweifelsfall alles zur Verfügung zu haben.
Soziale Risikofaktoren: Einsamkeit und Umfeld
Das soziale Umfeld spielt eine wichtige Rolle beim Entstehen und Aufrechterhalten einer Hortungsstörung.
Auffällig viele Betroffene leben allein³. Das Fehlen von Mitbewohnern oder nahestehenden Bezugspersonen bedeutet, dass keine „sozialen Korrektive“ vorhanden sind, die frühzeitig gegensteuern könnten³.
Gleichzeitig verstärkt das zunehmende Chaos oft die soziale Isolation: Aus Scham über den Zustand ihrer Wohnung ziehen sich Messies häufig zurück, vermeiden Besuch und verlieren weitere soziale Kontakte³.
Darüber hinaus kann ein familiär vorgelebtes Verhalten eine Rolle spielen. Wer in einem überfüllten Haushalt aufgewachsen ist, übernimmt leichter ähnliche Muster³.
Hier wirken sowohl genetische Prädispositionen als auch soziales Lernen: Kinder, die erleben, dass Gegenstände angehäuft und kaum entsorgt werden, internalisieren dieses Verhalten oft als normal.
Auch kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse sind nicht zu unterschätzen. Unsere Konsumgesellschaft fördert die Anhäufung von Gegenständen: Ständig verfügbare Produkte, aggressive Werbung und niedrige Preise erleichtern es, Dinge zu erwerben – während das Loslassen gesellschaftlich wenig trainiert wird³.
Komorbiditäten: Begleiterkrankungen und Überschneidungen
Das Messie-Syndrom tritt selten isoliert auf.
Sehr häufig leiden Betroffene zusätzlich an Depressionen, Angststörungen oder ADHS⁶. Studien zeigen, dass etwa 20 % der Erwachsenen mit ADHS auch klinisch relevantes Horten aufweisen⁶.
Das macht Sinn, da ADHS-typische Probleme wie Impulsivität, Planungsmängel und Organisationsschwierigkeiten auch das Horten begünstigen können⁶.
Früher wurde das Horten oft als Unterform der Zwangsstörung (OCD) eingeordnet. Heute weiß man: Auch wenn es Überlappungen gibt, ist pathologisches Horten ein eigenständiges Krankheitsbild¹.
Typische Zwangssymptome wie exzessives Kontrollieren oder Ordnungszwänge fehlen bei vielen Messie-Betroffenen vollständig¹.
Trotzdem können Zwangssymptome und Horten bei einzelnen Personen gemeinsam auftreten, was Diagnostik und Therapie erschweren kann¹.
Auch Autismus-Spektrum-Störungen werden mitunter bei Menschen mit ausgeprägtem Horten beobachtet⁶, vor allem bei solchen, die intensive Spezialinteressen oder Schwierigkeiten in der Emotionsregulation zeigen.
Verlauf und Chronifizierung
Das Messie-Syndrom beginnt häufig schleichend.
Erste Anzeichen zeigen sich oft schon im späten Kindesalter oder der Jugend, zum Beispiel durch Schwierigkeiten, alte Schulsachen oder Spielzeug auszusortieren³.
Im jungen Erwachsenenalter werden die Probleme deutlicher: Die Wohnsituation wird zunehmend unübersichtlich, Entscheidungen werden vermieden, und die emotionale Bindung an Gegenstände nimmt zu³.
Unbehandelt verschlimmern sich die Symptome in aller Regel über die Jahre hinweg¹.
Besonders im höheren Alter – ab etwa 60 Jahren – steigt die Prävalenz deutlich an, und die Wohnungen der Betroffenen sind oft so vollgestellt, dass wichtige Funktionen (z.B. Schlafen, Kochen, Hygiene) erheblich eingeschränkt sind³.
Soziale Isolation, körperliche Erkrankungen und zunehmende Immobilität verstärken den Teufelskreis.
Eine spontane Besserung ist selten.
Ohne gezielte therapeutische Unterstützung bleibt die Störung in der Regel chronisch bestehen¹.
Deshalb ist es entscheidend, pathologisches Horten frühzeitig zu erkennen und geeignete Hilfsangebote zu machen.
📚 Quellenverzeichnis
¹ Postlethwaite A., Kellett S., Mataix-Cols D. (2019). Prevalence of hoarding disorder: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 256, 309–316. DOI: 10.1016/j.jad.2019.06.004
² Mueller A., Mitchell J.E., Crosby R.D., Glaesmer H., de Zwaan M. (2009). The prevalence of compulsive hoarding and its association with compulsive buying in a German population-based sample. Behaviour Research and Therapy, 47(8), 705–709. DOI: 10.1016/j.brat.2009.04.005
³ Schröter V. et al. (2022). Bindung und Horten: Aktuelle Ergebnisse der Universität Freiburg.
⁴ Ivanov V.Z., Mataix-Cols D., Serlachius E., Lichtenstein P., Anckarsäter H., Lundström S. (2013). Prevalence, comorbidity and heritability of hoarding symptoms in adolescence: A population based twin study in 15-year olds. PLOS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0070286
⁵ Tolin D.F., Kiehl K.A., Worhunsky P., Book G.A., Maltby N. (2012). Anomalous neural circuitry related to object categorization and decision-making in hoarding disorder. Archives of General Psychiatry, 69(8), 833–841. DOI: 10.1001/archgenpsychiatry.2011.1980
⁶ Akıncı M.A., Turan B., Esin İ.S., Dursun O.B. (2022). Prevalence and correlates of hoarding behavior and hoarding disorder in children and adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry, 31(10), 1623–1634. DOI: 10.1007/s00787-021-01847-x
📚 Quellenverzeichnis
¹ Postlethwaite A., Kellett S., Mataix-Cols D. (2019). Prevalence of hoarding disorder: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 256, 309–316. DOI: 10.1016/j.jad.2019.06.004
² Mueller A., Mitchell J.E., Crosby R.D., Glaesmer H., de Zwaan M. (2009). The prevalence of compulsive hoarding and its association with compulsive buying in a German population-based sample. Behaviour Research and Therapy, 47(8), 705–709. DOI: 10.1016/j.brat.2009.04.005
³ Schröter V. et al. (2022). Bindung und Horten: Aktuelle Ergebnisse der Universität Freiburg.
⁴ Ivanov V.Z., Mataix-Cols D., Serlachius E., Lichtenstein P., Anckarsäter H., Lundström S. (2013). Prevalence, comorbidity and heritability of hoarding symptoms in adolescence: A population based twin study in 15-year olds. PLOS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0070286
⁵ Tolin D.F., Kiehl K.A., Worhunsky P., Book G.A., Maltby N. (2012). Anomalous neural circuitry related to object categorization and decision-making in hoarding disorder. Archives of General Psychiatry, 69(8), 833–841. DOI: 10.1001/archgenpsychiatry.2011.1980
⁶ Akıncı M.A., Turan B., Esin İ.S., Dursun O.B. (2022). Prevalence and correlates of hoarding behavior and hoarding disorder in children and adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry, 31(10), 1623–1634. DOI: 10.1007/s00787-021-01847-x